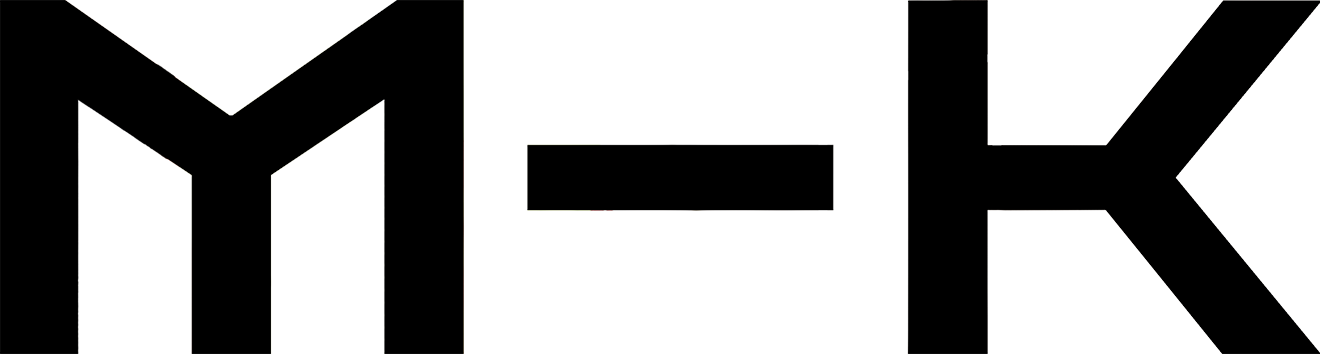„Du läufst immer zu laut.“
Okay. Ein Feedback. Und zwar eines, das mich irritierte. Zu laut laufen? Geht das? Als 1,64m große Person?
Anscheinend ja. Als einzige Frau in einer Gruppe männlicher Technologen, die alle 20-30 cm größer waren als ich, hörte ich: „Die anderen haben Angst vor dir. Schon, wenn sie deinen Schritt hören.“
Meine Irritation wurde durch diese vermeintliche Erklärung eher noch größer als kleiner.
„Du läufst immer so purposeful.“
Diese Erklärung half schließlich, dass der Groschen fiel: Ich war anders. Und das machte meinen Kollegen Angst.
In einer Gruppe, in der sich über die Jahre Muster etabliert und Arbeitsbeziehungen ausgebildet hatten (in vielen Fällen eine Art Nicht-Angriffspakt), war ich – mit meinen neuen Ideen und dem Willen, die Arbeit aller zu etwas Größerem zusammenzufassen – eine Bedrohung für den Status-Quo, wenn auch mit guten Absichten.
Der Weg zur Hölle und so…
Bis dahin war ich der Meinung, dass ich als Chemikerin in der Technologie alles andere als divers war. Aber hier in dieser Gruppe war ich plötzlich „Die Andere“. Nicht wegen meiner Ausbildung, sondern wegen der Art und Weise wie ich dachte – und lief.
Und das war für mich ebenso bedrohlich wie für meine Kollegen. Verstand ich meine Arbeit doch primär so, dass ich Menschen zusammen bringen wollte. Um gemeinsam an krassen Zielen zu arbeiten. Und nicht mal in meinem eigenen Team war es möglich, das zu schaffen ohne, dass sich Menschen von mir und meiner Art zu laufen bedroht fühlten?
Also traf ich eine Entscheidung, die im Rückblick falsch war und mich erstmals fast dazu brachte, das Unternehmen zu verlassen:
Ich passte mich an.
Ich passte mich an.
Zumindest so weit es mir möglich war. Das Großraumbüro wurde dabei zu meinem Endgegner.
Ein Ort, an dem man leise sein musste. Leise laufen. Nicht engagiert, inspiriert telefonieren. Als Kölnerin: unmöglich. Also: rein in den Cube. Aber von denen gab es nur wenige. Und wenn ich zu oft einen blockierte, würden die anderen dann denken, ich hielte mich für was besseres?
Also, wenn jemand anrief: rein in den Druckerraum. So konnte ich sicherstellen, dass niemand meine Telefonate inhaltlich mithörte, sich Sachen zusammenreimte, die ihm wieder Angst machten. Besser ich würde es lieber später in wohl dosierten Portionen an den Mann bringen. Bedeutete aber auch, dass ich jedes Mal Schweißausbrüche bekam, wenn jemand in den Raum kam, um seine Ausdrucke abzuholen. Was hatte er jetzt gehört? Und was verstanden?
Ich holte mir Hilfe bei einem unternehmensinternen Coach:
Er sollte mich zu einer guten, Technologie-kompatiblen Mitarbeiterin machen.
Ich benannte die Entwicklungsfelder, befragte mein inneres Team und bekam von meinem Coach die Frage: Bist du sicher, dass du da, wo du bist, richtig aufgehoben bist? In dem Team und im Chemie-Großunternehmen grundsätzlich?
Ich war vollkommen geschockt. Natürlich war ich das. Ich war eine Handwerkertochter. Ich konnte zwischen Vorstand und Produktionsmitarbeiter switchen und vermitteln. Ich hatte Kommunikations- und Chemieabschlüsse. Warum sollte ich plötzlich nicht dort hingehören?
Der Rat meines Coaches: Dann suche dir Energiequellen. Geh nicht mehr strategisch fürs Netzwerk Mittagessen, sondern mit Menschen, die du magst, die dir Kraft geben.
Und schaue, dass du so oft wie möglich aus dem Home Office arbeitest.
Zwei Ratschläge, die im Unternehmen – und vor Corona – komplett unintuitiv waren. Widersprachen sie doch allem, was notwendig war, um Karriere zu machen. Als ich sie hörte, war ich…erleichtert. Mir ging es um die Sache. Nicht um die Karriere. Die war immer nur Mittel zum Zweck, denn wenn man höher kam, dann hatte man ja mehr Einfluss. So meine Denke.
Aber wenn ich mich entscheiden müsste: Dann war mir die Sache wichtiger. Also: Homeoffice und Kraftspender. Nicht länger versuchen so zu sein wie die anderen, sondern schauen, sich so oft wie möglich in den Flow zu begeben.
Statt also das Unternehmen zu verlassen, startete ich dort das, was ich heute zu meinem eigenen Geschäft gemacht habe:
Mensch und Maschine in den Flow zu bringen.
Dazu hatte ich mit mir selbst starten müssen. Nicht indem ich weiter an meinen Schwächen arbeitete und so wurde wie die anderen, sondern indem ich meine Stärken annahm. Und meine Schwächen so gut es ging reduzierte. Ich baute mir meinen Job so wie ich ihn brauchte, um erfolgreich zu sein.
Heute nennt man das Job-Crafting.
Und ich entschied: Ich möchte näher an die Basis. Raus aus der globalen Technologie, rein in die Standorte. Hier war die Frage – gehörst du hier hin? – plötzlich ganz weit weg. Und blieb es dann auch für ein paar Jahre.
Sie kam wieder. Aber auf dem Weg hatte ich etwas ganz Wichtiges gefunden: mich und meinen Purpose.